Inhaltsverzeichnis

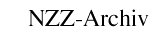
Endlich normal?
Zur Institutionalisierung homosexueller Partnerschaften
Deutschland, deine Sittlichkeit. Ein Hauch spätrömischer Zustände liegt über der Szene, seit die rot-grüne Bundesregierung ihren Entwurf eines Gesetzes vorgelegt hat, welches homosexuellen Paaren die Möglichkeit geben soll, sich vor dem Standesamt das Ja-Wort zu geben, einen gemeinsamen Namen anzunehmen, Steuervergünstigungen und Hinterbliebenenversorgungen zu erhalten. Eines Gesetzes, das für die dann in einem «Lebenspartnerschaftsbuch» beurkundete, sogenannte «eingetragene Lebenspartnerschaft» gegenseitige Fürsorge- und Unterhaltspflichten begründet, die Trennung der Paare erschwert (man muss dafür nun vor Gericht ziehen) und das auch sonst die homosexuelle Dauerbeziehung der heterosexuellen Ehe sehr, sehr ähnlich macht.
Von der Etablierung eines neuen «familienrechtlichen Instituts für gleichgeschlechtliche Paare» behaupten seine Urheber zwar mit Rücksicht auf das Grundgesetz, es wahre Abstand zur traditionellen Ehe. Volksmund und Presse aber rufen das Kind längst bündig beim Namen und stellen fest, nichts anderes als die Einführung der «Homo-Ehe» stehe bevor.
Wie soll man beschreiben, was hier geschieht? Einen «fatalen Schritt in die Degeneration» nannte der Fuldaer Erzbischof Johannes Dyba das geplante Gesetz. Das ist die Stimme der katholischen Orthodoxie, und von ihr dürfen wir ein solches Urteil wohl auch erwarten, aber zur Durchdringung der Lage fehlt es diesem Urteil denn doch an Soziologie. Eine Entwertung der Institution Ehe und damit die Zersetzung der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Staates, als deren «Keimzelle» die Ehe bekanntlich gilt, wittern konservative Familienpolitiker und Publizisten. Im Gegenteil!, erwidern liberale Geister. Wenn nun auch Homosexuelle nach standesamtlich besiegelter Zweisamkeit strebten, so bekunde sich darin ein Stabilitätsverlangen, das die Institution Ehe nicht schwächen, sondern stärken werde.
Paradoxien
Die Situation ist allerdings paradox. Auf den ersten Blick könnte man glauben, die linke Emanzipationsbewegung habe es nie gegeben, der Feminismus habe nie Radikalkritik geübt. Vergessen scheinen alle Einwände gegen die Ehe als Zwangsgemeinschaft, als Anstalt spiessbürgerlicher Erziehung zu Besitzgier und Eifersucht, als Repressionsinstrument, das die Frauen in die Abhängigkeit treibt und entmündigt. Vorbei die Zeit, da der mächtigste Verband der deutschen Homosexuellen seinen Mitgliedern ein «eindeutiges Bekenntnis zum Anderssein» abverlangte: «Reale Ausdrucksformen schwulen Lebens, die signifikant sind, wie offene und feste Partnerschaft unter Männern, Abenteuersexualität, Klappensexualität, anonymer Sex, Verletzung der Männlichkeitsnorm (Tuntigsein), sind zu benennen und zu bekennen.» In seiner heutigen Gestalt dagegen ist dieser Verband der aktivste Lobbyist für die Homo-Ehe. Gilt also, was der «Spiegel» für die Mehrheit der Lesben und Schwulen feststellt: «Jetzt ist Bürgerlichkeit angesagt»?
Der Satz kennzeichnet wohl eher eine Verschiebung in der allgemeinen Wahrnehmung. Die permissiven Linken unter den Homosexuellen sind keineswegs verstummt, vielmehr üben sie beissende Kritik am Integrationswillen ihrer eheliebenden Brüder und Schwestern. Nur findet man ihre Pamphlete nicht in den gängigen Medien, nicht einmal in der alternativen «taz», sondern muss sie in Periodika wie «Gigi – Zeitschrift für sexuelle Emanzipation» oder dem Online-Magazin «Siegessäule», einer Berliner Schwulenzeitung, suchen. Und was die Verbürgerlichung angeht, so gab es unter den Homosexuellen immer eine bürgerliche Mehrheit, die jedoch mit guten Gründen in Deckung blieb. Erst die endgültige Beendigung der strafrechtlichen Verfolgung, die Aids-Erkrankungen und das in den neunziger Jahren auf breiter Front vollzogene Outing homosexueller Prominenter haben der heterosexuellen Bevölkerung die Einsicht beschert, wie viele ihrer augenscheinlich braven Mitbürger gleichgeschlechtlichen Neigungen frönen: Nachbarn, Polizisten, Fernsehmoderatoren und Nachrichtensprecher, Schauspieler, Bundestagsabgeordnete und so fort.
Statt von Verbürgerlichung wäre besser von Normalisierung zu sprechen; einer Normalisierung im Sinne des Diskurstheoretikers Jürgen Link, der der Ansicht ist, dass «Normalität» in den modernen westlichen Gesellschaften zum höchsten Leitbild geworden ist. Link bezeichnet die Vorstellung von Normalität als «letzte regulative Idee» und meint, sie sei an die Stelle emanzipatorischer oder utopischer Werte getreten. Lauscht man der gegenwärtigen Diskussion um die Homo-Ehe, so wird man feststellen, dass sie ein ausgezeichneter Anwendungsfall für Links Theorie ist, denn wo immer die Kontrahenten aufeinander treffen, dreht sich ihr Disput alsbald um die Frage, wie normal oder anormal das
Ganze sei.
Normalität und Normativität
Das Tückische allerdings an Normalitätszuschreibungen ist, dass sie nur fliessende Übergänge kennen. Das unterscheidet die (statistisch ermittelte und medial kommunizierte) Normalität von der Normativität. Als es in Deutschland noch den Paragraphen 175 gab, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, besass man eine klärende Norm, die regelte, was als richtig und was als falsch zu gelten hatte. Heute fehlt sie, und das schafft, um mit Jürgen Link zu reden, «Denormalisierungsängste», da es dem Einzelnen schwerer wird, sich sozial und moralisch zu orientieren. Für die Empörungen, die das Gesetzesvorhaben zur Homo-Ehe begleiten, wäre es nicht die schlechteste Erklärung, sie als Fälle solcher Denormalisierungsangst aufzufassen.
Umfragen in Deutschland kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie in der Schweiz: Wie hier die Schaffung eines Instituts «registrierte Partnerschaft» mehrheitlich gutgeheissen, der Neudefinition der klassischen Ehe und ihrer Öffnung für schwule und lesbische Paare aber grosser Widerstand entgegengesetzt wird (NZZ 22. 6. 00), so begrüssen auch die meisten Deutschen die rechtliche Gleichbehandlung homosexueller und heterosexueller Lebensgemeinschaften in Einzelfragen (beim Recht auf ärztliche Auskunft über den erkrankten Partner, bei Miet- und Erbrecht, Rente und Steuern), schrecken aber vor einer Erweiterung des Ehebegriffs zurück. Die Lebensform «Ehe», mag ihr auch der Sozialcharakter homosexueller Partnerschaften bis aufs Haar angeglichen werden, bleibt für die allermeisten Menschen biologisch konnotiert – als Verbindung von Mann und Frau.
Sexualmoralische Vorbehalte also. Immer noch? Gewiss, und wie sollte es anders sein, schliesslich ist der Sexus in all seinen Triebregungen und moralischen Überformungen das grosse Spannungsfeld der An- und Abstossung, von Begehren und Abscheu. Aber man beachte, wie sich die Vorbehalte modernisiert haben. Auch heute ist Homosexualität nach herrschender Meinung nicht gleichwertig mit Heterosexualität. Sie ist nicht «genauso normal». Jedoch gelten Homosexuelle als gleichwertige Bürger, und als «nicht normal» würde es empfunden, ihnen staatsbürgerliche Rechte zu verweigern. Die Umfragen, die diese Haltung belegen, bekunden einen bemerkenswerten Schwund des Sexismus. Stets hat man Schwule und Lesben sexualisiert, hat ihr soziales Sein über ihre geschlechtliche Neigung definiert. Die exhibitionistischen Teile der Homosexuellenbewegung haben das Ihre dazu getan. Doch selbst wenn der Karneval am Christopher-Street-Day es weiterhin vermag, hie und da Bürgerschreck- Effekte zu erzielen, so ist doch die Ära der sexistischen Reduktion vorbei.
Zur «Aushöhlung» und «Entwertung» der bürgerlichen Ehe, um dazu noch eine winzige Bemerkung zu machen, braucht es die Homo-Ehe nicht. Das können andere Agenturen des Zeitgeistes besser. Ab Herbst präsentiert der Fernsehsender SAT 1 die Show «Wer heiratet den Millionär?», wo einem vermögenden Mann fünfzig heiratswillige Frauen vorgestellt werden. Nach mehreren Auswahlrunden soll er dann seine Zukünftige herausgefiltert haben und sie ehelichen. Spätkapitalistische Zustände? Beobachter könnten versucht sein, ihnen die «spätrömischen» glattweg vorzuziehen.
Joachim Güntner
Neue Zürcher Zeitung, 26. Juli 2000
© AG für die Neue Zürcher Zeitung NZZ 2000
