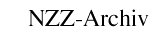

Neue Zürcher Zeitung LEBENSART Samstag, 26.06.1999 Nr. 145 125
Vom Glück, «anders» zu sein – ein Erfahrungsbericht
Christopher Street Day: 30 Jahre Kampf um gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichberechtigung Homosexueller
Mutter beugt sich vorsichtig zu mir herüber. «Sag mal», flüstert sie mir im Tram zu und deutet mit dem Kopf auf einen jungen Mann auf der anderen Wagenseite, «ist der . . . äh, . . . ist der auch vom anderen Ufer?» Das Vertrauen meiner Mutter ehrt mich. Bloss dass sie Schwule und Lesben mit der Freimaurerloge verwechselt. Woher zum Teufel soll ich denn wissen, ob jener junge Kerl auf Männer steht? Kraft eines Röntgenblickes vielleicht, den mir mein eigenes Lesbischsein wunderbarerweise beschert hätte? «Weiss ich doch nicht», entgegne ich. Sie lehnt sich zurück und seufzt. «Es gibt ja nur noch solche», stellt sie betrübt fest. «Dein Vater und ich», sagt sie, «dein Vater und ich sind jetzt vierzig Jahre miteinander verheiratet.» Oje, denk› ich, jetzt werde ich mir gleich eine Hymne auf die Kleinfamilie anhören dürfen, die zwar so zweifelhafte Subjekte wie mich hervorgebracht hat, aber nichtsdestoweniger als der beste aller möglichen Lebensentwürfe gilt. «Vierzig Jahre!» wiederholt meine Mutter verträumt und ruckt ihre Handtasche mit einer energischen Handbewegung auf ihren Schoss zurück. «Dein Vater und ich sind ja schon richtig pervers.»
So ist es. Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Wenn das Unglück vorbei ist, wenn die Bleiplatte der Schuld weggestemmt ist, wird es schwierig zu sagen, was sich verändert hat. Schwierig zu sagen, ob es der eigene Beitrag war oder ob man bloss vor ausgewechselten Kulissen spielt. Ich erinnere mich an die Erleichterung, als ich 1989 (oder war es 1990?) eine kurze Zeitungsmeldung las: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen. Ich freute mich über die Annahme der neuen Bundesverfassung, in der die Diskriminierung auf Grund der Lebensform geächtet wird. Und als 1992 mein erstes Buch, «Denn das ist das Schreckliche an der Liebe», erschien, wunderte ich mich über die freundliche Aufnahme einer lesbischen Trennungsgeschichte. Es gab eine Welt da draussen. Eine Welt, die weniger streng und moralisch war als mein Elternhaus.
In meiner Jugend gab es Schwule nur als Witz. Lesben gab es gar nicht. Es gab nachdrücklich auf den Unterteller gelegte Löffel. Es gab bedeutungsvoll glattgestrichene Röcke und ein Schweigen, das «Geheimnis, Geheimnis» blinkte, für ein Kind aber nicht zu entziffern war. Als Onkel Martin verschwand, den ich heiss und innig liebte, weil er mich als einziger in der Verwandtschaft mit mitgebrachten Spielzeugautos beglückte, gab es keine Erklärungen. Dass er schwul war und sich im Verlaufe einer schweren Depression das Leben genommen hatte, erfuhr ich erst Mitte Zwanzig. Rätselhaft auch die abfälligen Bemerkungen über den Gemeindeammann, der sonntags junge Männer in einem knallroten Cabrio spazierenfuhr. So etwas machte man nicht in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Das war doch «einfach ein Blöffer mit seinem roten Chlapf da». Es brauchte ein paar Jahre, bis ich begriff, dass nicht die Cabrios das Unanständige waren. Und es brauchte ein paar Jahre, um zu begreifen, warum es eine Gnade war, dass meine Mutter ihre «anders gewickelte» Lehrmeisterin weiterhin traf, warum letztere «trotzdem» eine Nette war und warum immer das überragende Talent dieser greisen Porzellanmalerin, die jeweils am Stock und in Begleitung einer resoluten Freundin erschien, ins Feld geführt werden musste, um ihren eigentlich unmöglichen Besuch zu rechtfertigen.
*
In der Dunkelheit des Ungesagten werden Botschaften hinterlegt. In der Dunkelheit des Ungelebten habe ich sie angstvoll gelesen. Lektion eins: Die Schwulen und die Lesben sind immer die anderen. Lektion zwei: Es ist ein Unglück, so zu sein. Lektion drei: Besser, man kennt keine wie «die». Und dann dämmert einer, dass sie selber so ist. Es gibt keine Worte dafür. Es gibt nur ein schleichendes Unbehagen, ein langsames Merken, dass alles nicht so läuft, wie es sollte. In der Buchhandlung fragt die, die auch «so» ist, nach den Büchern von Alexander Ziegler. Und steht Höllenqualen aus, bis die Buchhändlerin die Angaben aus dem Katalog geblättert hat. Es müssen’s alle sehen, dass die, die dieses Buch verlangt, auch «so» ist. «Ziegler, Alexander», sagt die Buchhändlerin laut. Man könnte sie erwürgen dafür, dass sie das Kainsmal so laut preisgibt vor versammelten Käuferinnen und Käufern an der Kasse. Dass es den anderen komplett egal sein könnte, ob ich «so» oder anders bin, dieser tröstliche Gedanke ist mir leider nie gekommen.
Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Hinterher ist es schwierig, sich zu vergegenwärtigen, wovor man eigentlich Angst gehabt hat. Vor nichts wahrscheinlich. Vor einer verschlossenen Türe, hinter der man Schreckliches erwartete und die, sobald man sie aufstösst, nur den Blick freigibt auf einen blühenden Garten. Es ist herrlich, lesbisch und mit sich selber einverstanden zu sein. Es ist wunderbar, sich lebendig zu fühlen, schamlos in die Ausschnitte von Frauen zu linsen, zu flirten, was das Zeug hält, und den Moralaposteln Paroli zu bieten. «Demokratie», so der inzwischen verstorbene François Mitterrand, «ist niemals ein Status quo. Sie muss täglich neu verteidigt und erkämpft werden.» So ist es wohl auch mit der Sache der Lesben und Schwulen. Es gibt keinen Status quo. Das in den letzten zehn, fünfzehn Jahren spürbar liberalisierte Klima, das im übrigen an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg anknüpft, ist nicht unbedingt ein Geschenk für die Ewigkeit. Es ist ein Erbe, das gepflegt, verteidigt und vermehrt werden muss. Es gibt Zeiten des Krieges, es gibt Zeiten des Friedens. Unbestritten aber scheint es mir zu sein, dass die Zeiten des Friedens immer die grösseren gewesen sind. Und dass auch gute Erfahrungen, so sehr sie von der Geschichte verschüttet sein mögen, nicht wirklich verlorengehen.
*
Neulich war ich mit meiner Mutter in der Kirche. Der Pfarrer predigte zum Thema des Gedächtnisses und führte aus, wie sehr die heilige Wandlung eine Aufforderung zur Erinnerung sei. Er machte den Sprung vom kollektiven Gedächtnis des Christentums zur individuellen Erinnerung und bat die Kirchgemeinde, sich an die schönsten Augenblicke im eigenen Leben zu erinnern. «So eine blöde Predigt», meinte meine Mutter verstimmt, als wir im wegstrebenden Pulk der Messgänger die Kirche verliessen. «Aha?» meinte ich etwas konsterniert. «Aber wieso denn?» Mir hatte die Predigt so ausnehmend gut gefallen, dass ich in allerlei angenehmen Erinnerungen schwelgte. «Schönste Augenblicke!» stiess meine Mutter verächtlich hervor. «Kannst du dich vielleicht an schönste Augenblicke erinnern? Also mir fällt dazu nichts ein. Da war immer ein Haken, wenn etwas schön war.» – «Bisseguet», sagte ich schwach abwehrend und bereits damit beschäftigt, nach einem Taxi Ausschau zu halten, das meine nur mühsam gehende Mutter und den schweigenden Vater zum Hotel fahren würde. «Dann sag mir mal, woran du dich erinnerst, wenn du so etwas Blödes wie ‹schönste Augenblicke› hörst!» fuhr mich meine Mutter an. Ich lachte. «Das werd› ich dir doch nicht erzählen», meinte ich und wurde, da sie ein beleidigtes Gesicht aufsetzte, doch ein bisschen genauer. «Na ja», sagte ich beschwichtigend, «Momente aus meinem Liebesleben halt. Und wie das war, als ich ohne Hilfsräder Fahrrad fahren lernte. Es war wie Fliegen. Es war so wunderbar, als Papi auf der Terrasse stand und sich ausschüttete vor Lachen, weil ich nicht bemerkt hatte, dass er meinen Gepäckträger losgelassen hatte. Das war ein schöner Moment zum Beispiel.» – «Komisch», sagte meine Mutter. «Ich kann mich an nichts erinnern. Bei mir war immer ein Haken dabei. Immer.»
Ich erinnere mich an den verklemmten Reissverschluss meiner ersten Geliebten, die ich so gern elegant und beiläufig aus ihrem Overall geschält hätte. Ich erinnere mich an die Küsse von D. und die flatternde Ungeduld, die mich befiel, wenn der Zug in Paris einfuhr und mich D. am Ende des Bahnsteigs erwartete. Ich erinnere mich an das Wohlsein am frühen Morgen mit der anderen D. und wie sie im Halbschlaf meine Hand packte, um sie sich aufs Geschlecht zu legen. Ich erinnere mich an ihre Gaben. An die Kassetten, an die Bücher, die sie mir schenkte. An die Genugtuung, die es bedeutete, sie in ein Café zu begleiten und dort Händchen mit ihr zu halten, ohne auf die irritierten Blicke der Kellner achten zu müssen. Ich erinnere mich an das würgende Gefühl, bestraft zu werden, weil ich einen Menschen, der eine Frau war, liebte und begehrte. Ich erinnere mich an die bösen Blicke, die ich amüsiert auf mich nahm, um sie mit der Kraft, ich selbst zu sein, zu neutralisieren. An alles erinnere ich mich. Auch an den Brummbären Dutli, der mir auf mein schamhaftes, an einer Supermarktkasse gemachtes Geständnis, dass ich nämlich nicht so auf Männer stünde, die schönste Antwort gab: «Kann ich verstehen», knurrte er. «Ich auch nicht.» Und natürlich erinnere ich mich an die Frauen und Männer, die mehr Mut hatten als ich und die das Recht auf gleichgeschlechtliche Liebe zu einer Zeit und in einer Umgebung eingefordert haben, in denen ich vor lauter Angst in die Hosen gemacht hätte. Man kommt nicht aus dem Nichts. Das zu erkennen ist ein Gewinn. Ich geniesse mein Leben, weil es vorher ein paar Vereinzelte gab, die sich für die Sache zerreissen liessen. Ich geniesse meine Erinnerungen im Bewusstsein über die Fragilität ihres Zustandekommens. Eines jedoch bleibt zu sagen: Was man genossen hat, kann einem niemand mehr wegnehmen. Was da war, kann immer wiederkommen. Sogar das Glück, lesbisch oder schwul zu sein.
Nicole Müller
© AG für die Neue Zürcher Zeitung NZZ 1999
